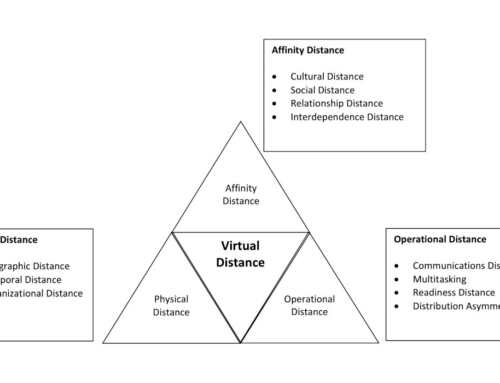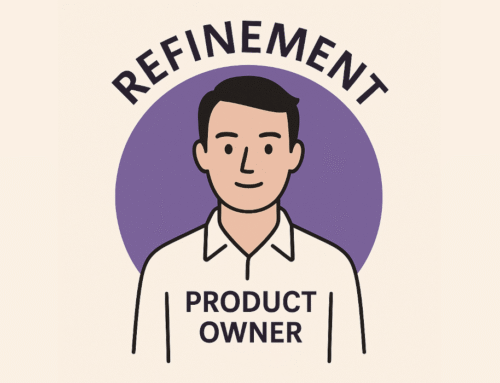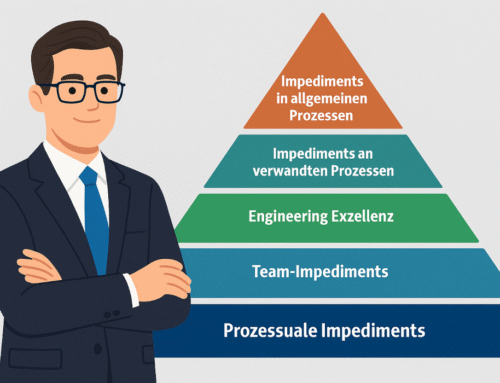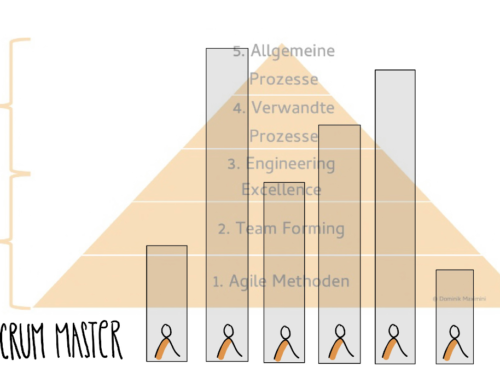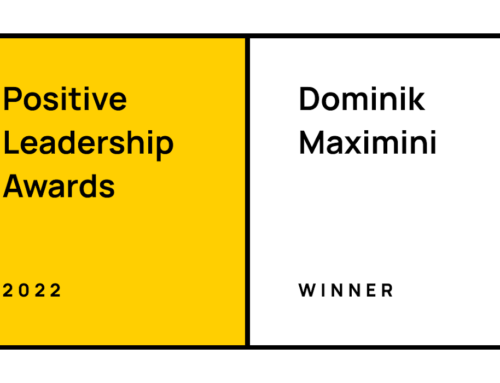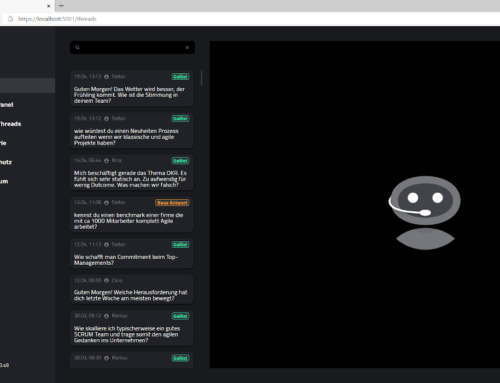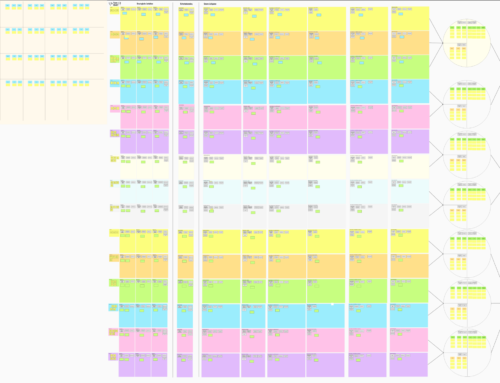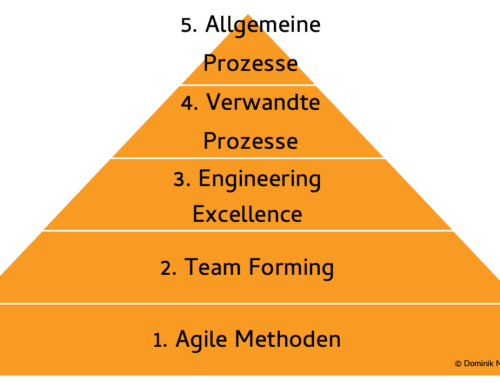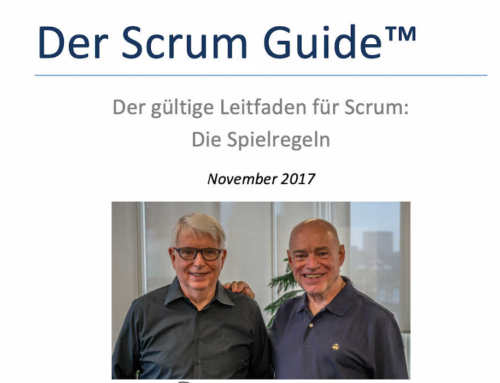Scrum gilt seit Jahren als das Framework der Wahl, wenn es um agile Produktentwicklung geht. Es verspricht Flexibilität, schnellere Ergebnisse, höhere Kundenzufriedenheit – und nicht zuletzt selbstorganisierte, motivierte Teams. Und doch hört man aus vielen Organisationen: „Scrum funktioniert bei uns nicht.“ Begleitet wird das aktuell in Social Media durch den „Agile-is-Dead“-Hype.
Aber stimmt das wirklich? Oder liegt das Problem ganz woanders?
In diesem Artikel zeige ich, warum Scrum oft scheitert – und warum das nicht an Scrum liegt, sondern an seiner Umsetzung.
1. Der Elefant im Raum: Verantwortung
Scrum basiert auf einem einfachen, aber radikalen Prinzip: Selbstorganisation (seit 2020: Selbstmanagement). Teams entscheiden selbst, wie sie ihre Ziele erreichen. Seit 2020 stellt der Scrum Guide sogar klar, dass Scrum Teams selbst darüber entscheiden, woran sie arbeiten, wann sie dies tun, wie sie es tun und wer es tut. Die Führungskraft sagt also nicht mehr „Was“ und „Wie“, sondern stellt lediglich den Kontext und die Rahmenbedingungen bereit.
Doch manche Teams sind nicht bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Woran liegt das?
-
Angst vor Fehlern: Wer sich nicht sicher fühlt, übernimmt keine Verantwortung. Viele Mitarbeitende sind es gewohnt, Aufgaben zugeteilt zu bekommen. Eigenständiges Entscheiden kann ein Risiko bedeuten, auch wenn dieses häufig „nur“ aus mehr Arbeit oder lauter Kommunikation besteht.
-
Fehlende Erfahrung: Nicht jedes Team ist sofort in der Lage, sich effektiv zu organisieren. Ohne Erfahrung oder Coaching (z.B. durch unsere Coaches von ValueRise Consulting) geraten viele schnell in Orientierungslosigkeit oder Konflikte.
-
Passiver Gehorsam als Norm: In vielen Organisationen ist noch das alte Denken präsent: „Sag mir, was ich tun soll, dann mache ich es.“ Scrum verlangt hier einen anderen Ansatz und Mitdenken ist nicht optional.
Selbstorganisation muss gelernt, begleitet und gewollt sein. Ganz interessant finde ich in diesem Zusammenhang beispielsweise diese Studie von 2017 (Lee / Edmonson: „Self-managing organizations: Exploring the limits of less-hierarchical organizing“).
2. Das Management-Problem: Kontrolle statt Vertrauen
Fast noch häufiger als am Team scheitert Scrum am Management. Denn auch hier ist ein Paradigmenwechsel nötig: Weg von Command & Control – hin zu Empowerment und Vertrauen. Doch viele Führungskräfte lassen das Team nicht wirklich selbstorganisiert arbeiten. Nicht einmal Sprintumfänge werden respektiert und mitten im Sprint werden zusätzliche Themen auf die Schultern der Entwickler geladen, ohne dafür etwas anderes herauszunehmen.
Typische Symptome:
-
Micromanagement bleibt bestehen, nur in agiler Verpackung.
-
Der Product Owner wird zur verlängerten Werkbank des Managements, statt als Vertreter der Anwender ernst genommen zu werden.
-
Stakeholder „besuchen“ Reviews nur alibimäßig oder erwarten dort Statusberichte. Ein echter Dialog oder das Ausprobieren des Produktes erfolgen nicht.
Kurz: „Scrum“ wird eingeführt, aber die Machtverhältnisse bleiben dieselben. Und solange das so ist, gibt es keinen Raum für echte Selbstverantwortung und keine Basis für empirisches Arbeiten.
3. Die Grundpfeiler werden ignoriert: Transparenz, Inspektion, Adaption
Scrum basiert auf empirischem Arbeiten und damit auf drei zentralen Prinzipien:
-
Transparenz: Alle Beteiligten haben Zugang zu denselben Informationen – z. B. über Fortschritt, Hindernisse und Prioritäten.
-
Inspektion: Es wird regelmäßig überprüft, ob das, was gerade passiert, noch zielführend ist. Statt Aktionismus sind stichhaltige Analysen gefragt.
-
Adaption: Erkenntnisse aus der Inspektion führen zu konkreten Änderungen – im Produkt, im Prozess oder im Verhalten.
Doch genau das passiert in vielen Unternehmen nicht:
-
Informationen werden politisch gefärbt oder verschleiert.
-
Retrospektiven sind reine Alibi-Veranstaltungen oder werden ganz gestrichen.
-
Entscheidungen werden nicht getroffen, verzögert oder basieren auf Bauchgefühl statt auf Fakten.
Woran liegt das?
Es fehlt an Vertrauen. Ohne Vertrauen traut sich niemand, ehrlich zu sein. Ohne Ehrlichkeit keine Transparenz. Ohne Transparenz keine sinnvolle Inspektion. Und ohne Inspektion keine sinnvolle Adaption. Was übrig bleibt, ist eine agile Simulation, kein „echtes“ Scrum. Amy Edmondson hat in diesem Zusammenhang das Konzept der „Psychologischen Sicherheit“ entwickelt und viel dazu publiziert, z.B. „Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams“ (1999).
4. Scrum nur auf dem Papier: Alter Wein in neuen Schläuchen
Viele Unternehmen sagen, sie würden mit Scrum arbeiten. Was sie damit meinen, ist: Sie machen weiter wie bisher, nur mit neuen Begriffen.
Ein paar Beispiele:
-
„Projektleiter“ wird zum „Scrum Master“ – seine Aufgaben bleiben die gleichen.
-
„Meilensteine“ heißen jetzt „Sprints“ – aber die Deadline-Logik bleibt.
-
„Pflichtenheft“ wird zum „Product Backlog“ – aber die Inhalte sind fix und unverhandelbar.
Das ist kein agiler Wandel – das ist agiles Theater. Solange die Denkmuster und Entscheidungsprozesse nicht hinterfragt werden, ist jedes Framework zum Scheitern verurteilt. Scrum ist keine Methode, die man „mal eben“ einführen kann. Scrum beinhaltet neben ein paar Rollen und Regeln vor allem eine Denkweise, ein Betriebssystem für die Zusammenarbeit im komplexen Umfeld. Dies erfordert echte Veränderung, keine Umetikettierung.
5. Die unbequeme Wahrheit: Scrum deckt Probleme auf – es erzeugt sie nicht
Oft hört man: „Seit wir Scrum machen, läuft es schlechter.“
Die Realität: Scrum macht Probleme sichtbar, die vorher schon da waren. Dazu ist Scrum da. Deshalb funktioniert es nach dem Prinzip Transparenz, Inspektion, Adaption.
Typische Beispiele aus dem Praxisalltag:
-
„Wir sind viel langsamer als vorher“ → Das Team war vorher schon langsam, dies wurde aber durch konsequente Überplanung verschleiert. Also viel Bewegung, wenig Fortschritt. Nimmt man jetzt die Bewegung raus, wirkt das Team plötzlich langsamer als zuvor, obwohl es häufig sogar etwas schneller arbeitet.
-
„Wir streiten ständig“ → Es gab schon lange ungelöste Spannungen, jetzt kommen sie ans Licht, denn Scrum ermöglicht es nicht mehr, sich hinter Meilensteinen, Terminplänen und Kollegen zu verstecken. Volle Transparenz, jeden Tag.
- „Es wird alles zu Tode diskutiert“ → früher wurde über Zyklen von sechs bis zwölf Monaten entschieden und entsprechend waren die Diskussionen über einen langen Zeitraum verteilt. Nun werden Entscheidungen binnen weniger Tage benötigt und plötzlich fällt auf, wer da alles mitreden möchte.
Scrum legt den Finger in die Wunde – und das tut weh. Aber es ist auch eine Chance: Wer hinschaut, kann wirklich etwas verändern.
Fazit: Scrum scheitert nicht – wir scheitern daran, es wirklich zuzulassen
Scrum ist weder einfach noch ein Allheilmittel. Es ist ein durchdachter, erprobter Rahmen für komplexe Herausforderungen – wenn man ihn ernst nimmt. Scrum braucht Vertrauen, Lernbereitschaft und Führung, die loslassen kann, ohne dabei die Menschen allein zu lassen.
- Wenn Teams Verantwortung übernehmen dürfen und dabei begleitet werden,
- wenn Management bereit ist, Kontrolle abzugeben,
- wenn Transparenz und Lernen wirklich gelebt werden,
- dann kann Scrum enorme Kraft entfalten.
Was heißt das für dein Unternehmen?
-
Fang mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme an: Was davon leben wir wirklich – und was ist nur Fassade? Wo brauchen wir überhaupt Scrum und wo glauben wir, dass uns andere Ansätze besser helfen?
-
Investiere in Coaching und Kulturarbeit, nicht nur in Trainings. Zwei Tage mit einem guten Trainer sind toll, aber du wurdest auch kein guter Autofahrer durch zwei Tage mit dem Fahrlehrer.
-
Akzeptiere, dass Veränderung weh tut – aber sie lohnt sich. Folge dabei immer den alles entscheidenden Fragen: „Funktioniert das, was wir heute tun?“ und falls die Antwort „Ja“ lautet: „Funktioniert das gut?“ Ändere nur etwas, wenn die Antwort auf eine der Fragen „Nein“ ist.
Das Problem der komplexen Produktentwicklung ist aktueller denn je – steigende Dynamik, kürzere Innovationszyklen, unsichere Märkte. Ein Framework wie Scrum wird meiner Meinung nach weiterhin gebraucht. Aber es entfaltet seine Wirkung nur im richtigen Umfeld. Tagtäglich sehen wir bei unseren Kunden Fälle, in denen es hervorragend funktioniert – und welche, bei denen aus den oben genannten Gründen überhaupt nichts läuft.
Wie lauten deine Gedanken dazu? Lass uns gerne daran teilhaben.