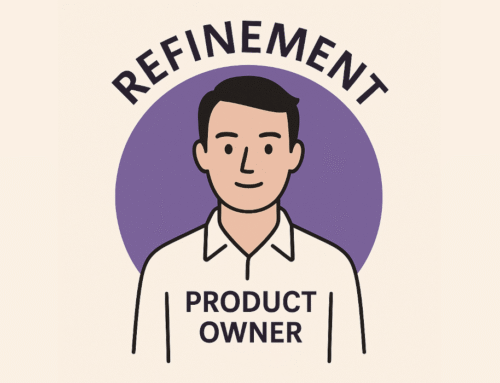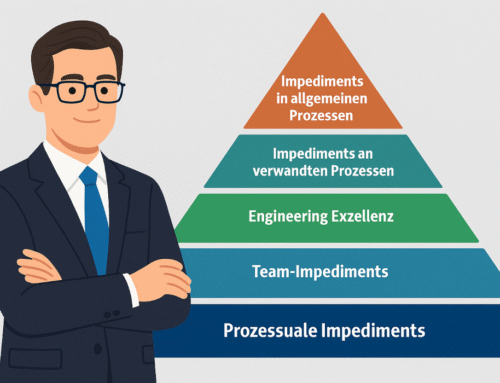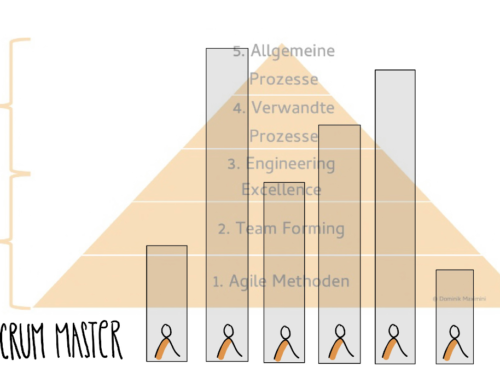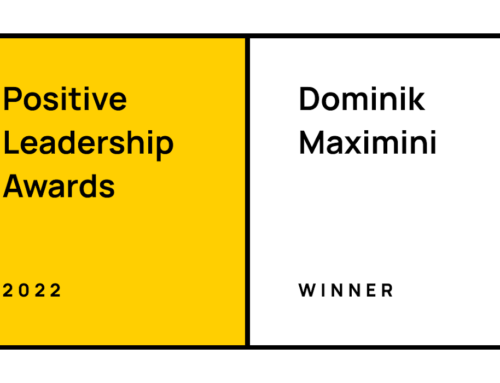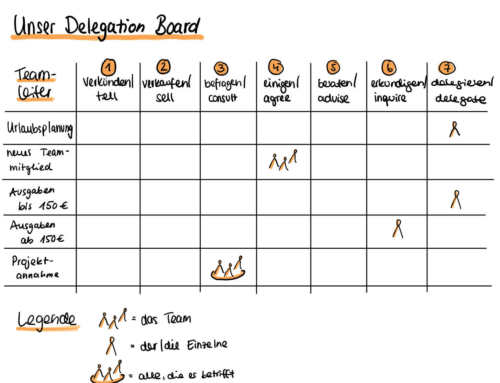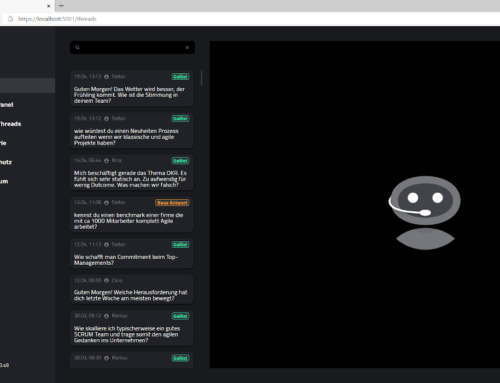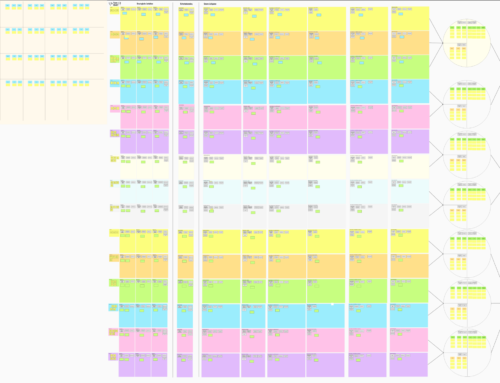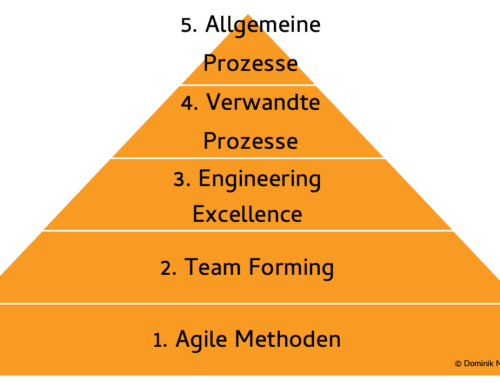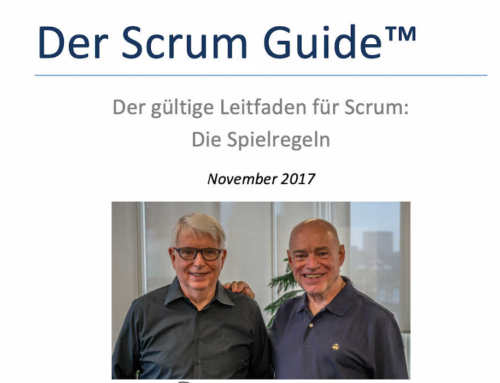Seit der Covid-19-Pandemie gehört virtuelles Arbeiten zum Alltag für die meisten von uns – auch für uns bei ValueRise Consulting. Das Thema ist aber nicht neu. Beispielsweise wurde mir in meinem allerersten Scrum-Training vermittelt, dass Teams im selben Raum („collocated“) 40% effektiver seien als Teams, die verstreut (Teammitglieder eines Teams an verschiedenen Orten) oder verteilt (verschiedene Teams jeweils komplett an unterschiedlichen Orten) arbeiten. In meinem Alltag habe ich nun schon ganz verschiedene Teams kennengelernt – mit sehr unterschiedlicher Produktivität. Diese hängt meiner Erfahrung nach nicht immer vom Arbeitsort (virtuell oder im selben Raum) ab. Es gibt jedoch Erfolgsfaktoren, die beachtet werden sollten. Ein meiner Meinung nach sehr gutes Buch aus dem Jahr 2008 ist „Uniting the Virtual Workforce: Transforming Leadership and Innovation in the Globally Integrated Enterprise“ von Karen Sobel Lojeski und Richard R. Reilly. Es beschreibt das „Virtual Distance Model“, was erklärt, aus welchen Gründen die Performance insbesondere in virtuellen Teams leiden kann.
Was sind virtuelle Teams?
Das Arbeiten von zuhause aus oder an verschiedenen Standorten wird immer populärer. Auf diese Weise lässt sich eine bessere Work-Life-Balance erreichen, der allmorgendliche Stau vermeiden und Arbeitskräfte ins Projekt einbinden, die man lokal möglicherweise nicht zur Verfügung hat. Arbeitet ein Team also mit Mitgliedern, die nicht im selben Raum sitzen, so spricht man von einem „virtuellen Team“. Unter diesem Oberbegriff gibt es zwei Ausprägungen: Verteilte und verstreute Teams.
Verteilte Teams haben zwei oder mehr Subteams, die jeweils für sich arbeitsfähig sind, an verschiedenen Standorten. Hier geht es also darum, die Schnittstellen zwischen den Teams zu managen. Die Mitglieder verstreuter Teams sitzen einzeln an verschiedenen Standorten, wobei das Team als Ganzes ohne diese Personen nicht arbeitsfähig ist. Es geht also darum, die Interaktionen zwischen diesen Einzelpersonen zu organisieren.
Dabei beginnt virtuelle Arbeit nicht erst in Indien: Schon wenn Menschen 15 Meter oder eine Treppe zwischen sich haben, greifen sie oft lieber zur E-Mail als zum persönlichen Gespräch.
Das Virtual Distance Model

Die Autoren Karen Sobel Lojeski und Richard R. Reilly fassen den Begriff der „virtuellen Distanz“ weit und gehen davon aus, dass jede zwischenmenschliche Interaktion dieser Distanz unterliegt. Sie hat grundsätzlich drei Dimensionen: Physical Distance („physische Distanz“), Operational Distance („Operationale Distanz“) und Affinity Distance („Nähe-Distanz“).
1. Physical Distance
Die physische Distanz besteht aus mehreren Dimensionen. Natürlich spielt die geografische Entfernung (Stockwerk, Stadt, Land,…) eine Rolle. Aber auch temporale Distanz und organisationale Distanz sind wichtig. Die temporale Distanz ist immer dann groß, wenn Menschen asynchron arbeiten. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Menschen in unterschiedlichen Zeitzonen zusammenarbeiten. Auch wenn Menschen zu unterschiedlichen Zeiten mit der Arbeit beginnen oder aufhören, liegt dieses Phänomen vor.
Organisationale Distanz bedeutet, dass es im Regelfall eine gefühlte (oder auch physikalisch vorhandene) Distanz zwischen Abteilungen (immerhin bedeutet das Wort, etwas ab-zu-teilen) oder Unternehmen. Man merkt das immer schnell, wenn über „die“ und „wir“ gesprochen wird.
Du siehst, physische Distanz bedeutet weit mehr, als nur in verschiedenen Ländern zu sein.
2. Operational Distance
Auch die operationale Distanz hat mehrere Facetten. Grundsätzlich umfasst sie die Rahmenbedingungen und Tools der verteilten Arbeit. Die Elemente sind Communications Distance, Multitasking, Readiness Distance und Distribution Asymmetry. Die Kommunikationsdistanz beschreibt im Wesentlichen die Bandbreite an Informationen, die durch den gewählten Informationskanal übertragen wird. Die größte Bandbreite hat ein persönliches Gespräch, wenn man sich direkt gegenübersitzt. Danach folgen die Videokonferenz und das Telefonat. Beides überträgt die Stimme, das Video immerhin noch ein Bild. Die nächste Stufe ist die schriftliche, synchrone Kommunikation, also Chat. Erst danach folgen asynchrone Kommunikationskanäle wie Dokumentation oder Email. Wie oft ist es dir schon passiert, dass du die Informationen in einer Email falsch formuliert oder interpretiert hast und es danach zu einem Konflikt kam? Mir jedenfalls schon öfter.
Je besser die Bandbreite des gewählten Kommunikationskanals, desto geringer ist die Kommunikationsdistanz, wobei man für jeden Kontext den richtigen Mix finden muss.
Multitasking wirkt gleich doppelt auf die Distanz: Einerseits sorgt die schiere Anzahl Personen mit denen man dann zu tun hat dafür, dass man sich dem Einzelnen weniger nah fühlt. Da gibt es schließlich noch 20 andere, die auf mich warten. Andererseits fühlt man sich als Mensch meist den Kollegen besonders nah, die neben einem sitzen. Wenn also der Kollege links von mir um etwas für Projekt A bittet, dann kommt man dieser Bitte eher nach, als wenn ein Kollege aus dem 200 km entfernten Team ein Anliegen zu Projekt B hat. Selbst dann, wenn Projekt B viel wichtiger ist als Projekt A. Je verteilter mein Team arbeitet, desto wichtiger wird es also, die Teammitglieder nur an genau einem Projekt/Produkt/Thema arbeiten zu lassen.
Die Bereitstellungs-Distanz kann diese Bemühungen allerdings schnell wieder zunichte machen. Sie beschreibt die entstehende emotionale Distanz durch Technik, die nicht rechtzeitig bereitgestellt wird. Hattest du schonmal eine Konferenz, in der die Teilnehmer nicht miteinander sprechen konnten, weil zunächst die PIN gefehlt hat, dann die Videoverbindung nicht funktionierte und zuletzt die Sprachqualität so schlecht war, dass man nichts so richtig verstanden hat? Solche Situationen führen dazu, dass die Teilnehmer schon emotional involviert (sprich: genervt) sind, bevor es überhaupt richtig los geht. Das wiederum trägt nicht dazu bei, dass die Ergebnisse besser werden – sondern nur, dass die Teilnehmer schnell wieder aus dem Meeting verschwinden wollen. Die Lösung ist, Technik bereitzustellen, die funktioniert – und jemanden diese rechtzeitig vor dem Meeting vorbereiten zu lassen.
Das letzte Puzzleteil der operationalen Distanz ist die Verteilungsasymmetrie. Sie beschreibt die ungleiche Verteilung des Personals über verschiedene Standorte. So könnten zum Beispiel zwei Mitarbeiter am entfernten Standort sitzen und fünf im Hauptquartier. Das führt schnell wieder zu einem „wir gegen die“-Verhalten, das noch dadurch verstärkt wird, dass die größere Personengruppe in der Regel schon durch Kaffeepausen abgestimmt ist und so das Gefühl entsteht, man müsse den anderen beiden ständig Dinge erklären, die doch „eh klar“ seien. Zu lösen ist dieser Umstand durch Transparenz und die Schaffung gleicher Voraussetzungen für alle, also die gleiche Anzahl Personen pro Standort im Team oder der Zwang, dass alle Mitarbeiter sich remote vom Laptop zum Meeting einwählen, statt zu fünft in einem Raum zu sitzen und gemeinsam über „die zwei Remotees“ zu meckern.
3. Affinity Distance
Die aus meiner Sicht wichtigste Facette des Modells ist die „Nähe-Distanz“. Sie besteht aus der kulturellen und sozialen Distanz, aus der Beziehungsdistanz und der Abhängigkeitsdistanz. Diese Aspekte können allesamt auch dann auftreten, wenn die Kollegen am selben Schreibtisch sitzen. Die kulturelle Distanz ist in den meisten Unternehmen im Bewusstsein vorhanden, insbesondere wenn man mit Menschen aus weit entfernten Ländern kooperiert. Allerdings greift das zu kurz: Auch innerhalb Deutschlands gibt es kulturelle Unterschiede, für die man die Mitarbeiter sensibilisieren muss. Mich überrascht beispielsweise immer wieder die berühmte „Berliner Schnauze“.
Die soziale Distanz beschreibt den gesellschaftlichen Status der Personen im Vergleich zueinander. Neben unterschiedlichem (relativen) Einkommen können auch Titel und andere Faktoren dazu beitragen, Distanz aufzubauen. Stelle dir die „Senior Architektin“ Petra vor, die seit 20 Jahren im Unternehmen ist und selbstverständlich promoviert hat. Dann stelle dir Michael vor, der gerade seine Ausbildung abgeschlossen hat und als Fachinformatiker ins selbe Team kommt. Formal sind die beiden möglicherweise gleichgestellt, wahrscheinlich führt das aber wiederholt zu Konflikten oder dazu, dass Michael seine Ideen für sich behält. In diesem Beispiel ist das natürlich offensichtlich. In der Praxis geht es um die feinen Nuancen, die man im Team betrachten und adressieren muss, wenn man diese Form der Distanz minimieren will.
Die Beziehungsdistanz wird von den Autoren beschrieben als „the extent to which you and others lack relationship connections from past work initiatives“. Vereinfacht gesagt wissen die Kollegen bei einer hohen Beziehungsdistanz nicht, ob sie sich gegenseitig vertrauen können. Sie fühlen sich fremd und unbekannt. Mir geht es zum Beispiel so, wenn ich auf eine Party komme, auf der ich niemanden kenne: Erstmal bin ich zurückhaltend und muss mich überwinden, andere anzusprechen. Meine besten Ideen würde ich dort erstmal nicht breit streuen…
Die Abhängigkeitsdistanz hat mehrere Nuancen. Einerseits geht es um die Frage, wie abhängig zwei Menschen voneinander sind, zum Beispiel wirtschaftlich. Hängt mein Überleben an dem Auftrag, den ich gerade abarbeite? Dann bin ich nicht auf Augenhöhe und verhalte mich ggf. anders als wäre das nicht der Fall. Andererseits geht es um das Verfolgen einer gemeinsamen Vision. Bei einer hohen Abhängigkeitsdistanz laufen die Kollegen nicht in dieselbe Richtung und geben kein Commitment für einander ab. Vielleicht hast du auch schonmal den Satz gehört: „Mein Teil ist fertig; muss seinen Code reparieren, das ist nicht mein Problem!“
Auftreten der Distanzfacetten
In jedem Kontext, in dem mehrere Menschen miteinander arbeiten, treten alle oben genannten Distanzen auf. Allerdings ist die Ausprägung und insbesondere der Schweregrad sehr unterschiedlich. Es ist die Aufgabe aller Beteiligten, insbesondere der Führungskräfte, diese Elemente und deren Auswirkungen transparent zu machen und zu adressieren. Virtuelle Distanz ist etwas ganz Natürliches und nicht per se schlecht. Je besser du es schaffst, die virtuelle Distanz zu reduzieren, desto produktiver wird dein Team sein.
Wege, die virtuelle Distanz zu reduzieren
Es gibt auf der einen Seite die offensichtlichen Maßnahmen: Interkulturelle Trainings, feste Kernarbeitszeiten, funktionierende Technik, Laptopkameras und eine hochwertige Internetverbindung. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Maßnahmen, die nicht immer sofort offensichtlich sind. Da wären zum Beispiel „Raumkameras“. Diese Kameras hängen bei jedem Team (oder der Einzelperson) im Raum und sind immer angeschaltet. Darunter hängt ein Bildschirm, auf dem die anderen Raumkameras jederzeit zu sehen sind. Zusammen mit einer Soundverbindung hilft das, das Bewusstsein für die anderen aufzubauen und sich informell auszutauschen. Auch Präsenzroboter sind sehr hilfreich. Sie machen die entfernt arbeitende Person autonom, weil sie selbst an Plakate heranfahren oder den Kamerawinkel ändern kann. Nach kurzer Zeit fällt den Kollegen oft gar nicht mehr auf, dass der Roboter gar kein Mensch aus Fleisch und Blut ist, denn er spricht und reagiert wie die Kollegin, die ihn steuert.
Eher weichere Maßnahmen, die aber noch wichtiger sind, betreffen den Aufbau der persönlichen Bindung. Hierzu hat es sich bewährt, in der Anfangsphase der virtuellen Zusammenarbeit alle Kollegen für eine Zeit von 4-8 Wochen an einen Standort zu bringen. Idealerweise in Form eines „Kollegenaustauschs“, also die Zeit gleichmäßig auf die Standorte aufgeteilt. Je mehr Standorte es gibt, desto länger dauert diese Phase. Man lernt sich persönlich kennen, erfährt von den Ecken, Kanten und dem Privatleben der Anderen und schließt vielleicht sogar Freundschaft. Zumindest weiß man danach sehr genau, wer sich hinter der Emailadresse verbirgt. Nach dieser gemeinsamen Phase lohnt es sich, einen „Botschafter“ an jedem Standort zu belassen. Dieser kann an kulturelle Besonderheiten erinnern und nach einiger Zeit rotieren. So wird der andere Standort physisch präsent. Etwa zweimal im Jahr sollte man aber alle Kollegen an einen wechselnden Standort bringen, um die persönliche Bindung wieder zu festigen.
Das gelingt auch, wenn man die „drei Bs“ anwendet: Bier, Bowling und Barbecue. Die Getränkewahl ist natürlich frei, für gutes Essen sollte gesorgt werden. Bowling steht als Synonym für eine gemeinsame körperliche Aktivität, die viel Raum für Gespräche lässt und in der die meisten Kollegen gleich schlecht sind. Zumindest sollte die in der Teamhierarchie höchste Person nicht auch in dieser Aktivität die Beste sein. So können auch statusniedrigere Kollegen zeigen, was in ihnen steckt. Das öffnet den Raum für informelle Gespräche und Wertschätzung.
Selbstverständlich gibt es noch viele weitere Maßnahmen, die ergriffen werden können. Deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.
Fazit
Das Virtual Distance Model erklärt gut, wie es zu Friktionen in Teams kommen kann. Das betrifft insbesondere solche, die virtuell arbeiten. Während die technischen Rahmenbedingungen von den Unternehmen heute weitestgehend beherrscht werden, gibt es bei den weicheren Faktoren regelmäßig Handlungsbedarf. Ich hoffe, dass dir dieses Modell dabei hilft, deinen eigenen Kontext aus einer neuen Perspektive heraus zu betrachten.